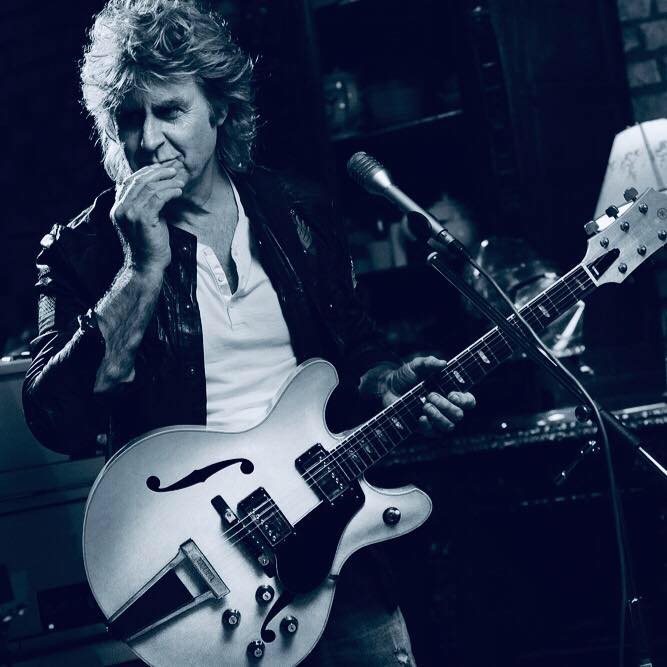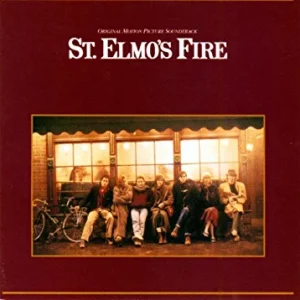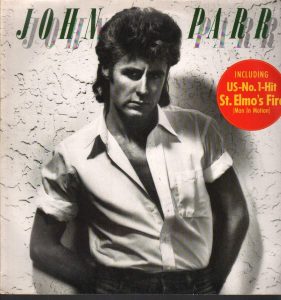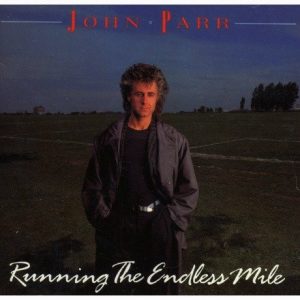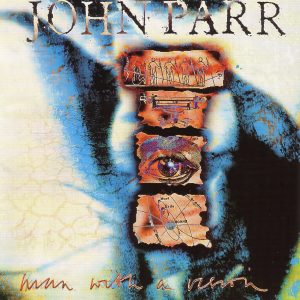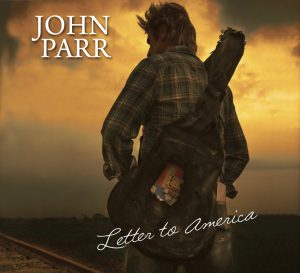© JUNGE FREIHEIT Verlag GmbH & Co. KG www.jungefreiheit.de 5/25 / 24. January 2025
Karriere zwischen Glück und Talent
Filmgeschichte: Vor hundert Jahren wurde der Hollywood-Schauspieler Paul Newman geboren
Daniel Körtel
Wie sehr kann doch der Zufall den Erfolg eines Lebenswegs bestimmen. Als Paul Newman nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Kenyon College in Ohio eine Ausbildung anstrebte, war Schauspiel nicht seine erste Wahl. Erst der Rauswurf aus dem Footballteam nach einer Studentenschlägerei brachte ihn zur Theatergruppe. Zwar hatte er vorher schon erste Schauspielerfahrungen gesammelt, doch erst hier sollte sich sein Talent, das ihn auf einen Karriereweg zu den Größten Hollywoods führen sollte, voll entfalten.
Geboren wurde Paul Newman am 26. Januar 1925, vor genau 100 Jahren, in Shaker Heights, einer Vorstadt von Cleveland. Sein Vater war ein alteingesessener Geschäftsinhaber für Sportartikel, während seine Mutter in ihren Jugendjahren aus Habsburg-Österreich einwanderte. Die Familie war wohlhabend und schaffte es sogar unbeschadet durch die schweren Jahre der Weltwirtschaftskrise. Die jüdische Herkunft väterlicherseits – seine Mutter war eine „atheistische Katholikin“ – spielte in der säkular eingestellten Familie keine Rolle. Sie versperrte ihm jedoch aufgrund eines in dieser Zeit weitverbreiteten Antisemitismus manche Wege.
Am Kenyon College der freien Künste zeigte sich, wie sehr Newman – zu seiner eigenen Überraschung – mit seinem guten Aussehen und der energiegeladenen Bühnenpräsenz das Publikum in seinen Bann ziehen konnte. Erste Theaterengagements, auch am Broadway, machten Hollywood auf ihn aufmerksam. Der Durchbruch kam 1958 mit dem Erfolg des Südstaatendramas „Die Katze auf dem heißen Blechdach“, das ihm eine erste Oscar-Nominierung eintrug. Weitere Kassenschlager folgten, und Newman zählte mit Richard Burton und Liz Taylor zu den ersten Schauspielern mit Millionengage.
Newman sprach vor allem zwei Gruppen an: mit seinem Sexappeal die amerikanischen Frauen und seiner souverän-lässigen Art die amerikanischen Männer, wie sie sich am liebsten sahen. So wie in „Der Unbeugsame“ (1967), in welchem Newman einen Sträfling darstellte, der sich gegen ein rigides Gefängnissystem zur Wehr setzt.
Ab den siebziger Jahren war Newman soweit etabliert, daß er sich die Rollen freier aussuchen konnte. Es trieb ihn dabei stärker ins Charakterfach. Ein Höhepunkt war dabei „The Verdict“ von 1982, in welchem er die Rolle eines heruntergekommenen, alkoholkranken Anwalts in einem Schadensersatzprozeß übernahm. In diesem Meisterwerk von Sidney Lumet übertraf er sich selbst, indem er in einer Art Selbstoffenbarung viele seiner eigenen Emotionen preisgab. Wieder wurde er für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert – und wieder ging er leer aus.
Auf sich selbst hatte er immer den kritischsten Blick
Die begehrte Trophäe erhielt er dennoch wenige Jahre später für „Die Farbe des Geldes“ (1986), ein spätes Sequel seines Dramas „Haie der Großstadt“ (1961) um einen um Geld spielenden Poolbillardspieler. Zusammen mit dem damals noch jungen und aufstrebenden Tom Cruise wirkte der Film von Martin Scorsese wie eine Staffelübergabe zweier Schauspielgenerationen.
Gleichwohl blieb Newmans Privatleben nicht von persönlichen Tragödien verschont. Scott, sein Sohn aus erster Ehe, starb 1978 an einer Überdosis Drogen. So verband ihn mit anderen Hollywood-Größen seiner Generation wie Marlon Brando und Gregory Peck das problembeladene Verhältnis zu einem Sohn, der anscheinend an der schweren Bürde seines berühmten Vaters zugrunde ging.
Zunehmend problematisch entwickelte sich sein exzessiver Alkoholkonsum, bis er kurioserweise durch seine Rolle im Film „Indianapolis“ (1969) in Autorennen den passenden Ersatzkick gefunden hatte, „weil die Ergebnisse so wunderbar eindeutig waren“. Mehrfach nahm er an Spitzenpositionen bis in seinen Siebzigern an bedeutenden Rennen wie in Daytona und Le Mans teil.
Bekannt wurde Newman auch für sein großzügiges karitatives Engagement, oftmals anonym. Seine Kreation „Newman’s Own“, ein mit seinem Namen und Bild auf den Flaschen versehenes Salatdressing, erbrachte Millionengewinne, die vollständig wohltätigen Zwecken zugute kamen. Und obgleich er sich selbst als „emotionalen Republikaner“ empfand, unterstützte er die Bürgerrechtsbewegung sowie den linken Demokraten und Nixon-Gegenspieler Eugene McCarthy.
Als Newman 2008 im Alter von 83 Jahren verstarb, ging mit ihm einer der größten Titanen Hollywoods, der frei von schmutzigen Skandalen blieb, integer und ohne jede Eitelkeit. Auf sich selbst hatte er jedoch immer den kritischsten Blick, so daß man von einem „Hochstapler-Syndrom“ sprechen muß, von jemande, der sein Können chronisch unterbewertet, seine Leistungen mehr dem Glück als seinem Talent zuschreibt und so als unverdient betrachtet. Vielleicht liegt hierin eine der tieferen Wurzeln seines philanthropischen Engagements, als ginge es ihm darum, etwas wiedergutzumachen. Über ihn selbst sagte später seine Tochter Melissa: „Da war jemand, der sich für einen Hochstapler hielt, für einen ganz normalen Mann mit einem außergewöhnlichen Gesicht, der das Glück auf seiner Seite hatte und weit mehr erreichte, als er sich überhaupt vorgestellt hat.“
 | Paul Newman Das außergewöhnliche Leben eines ganz normalen Mannes: Die Autobiografie Heyne Verlag 368 Seiten, 2022 25,00 EUR |