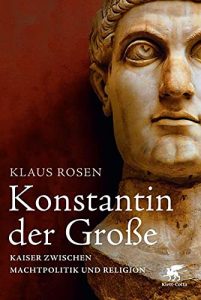Israel: Das erste Weihnachten nach dem Gaza-Krieg / Touristen und Pilger meiden das Heilige Land
Daniel Körtel
Die laute Musik einer Kapelle von Dudelsackspielern und Trommlern erfüllt den mit einer Krippe und einem rund 20 Meter hohen Weihnachtsbaum geschmückten Platz vor der Geburtskirche in Bethlehem. Christliche Stadtbevölkerung, palästinensische und internationale Pfadfindergruppen stehen bereit. zum traditionellen Empfang des Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, am Nachmittag vor Heiligabend, der erste nach Ende des zweijährigen Kriegs in Gaza.
Doch der einheimische Fremdenführer Elias (25, Name geändert) hält sich nicht lange hier auf. Stattdessen führt er den Besucher in die Geburtskirche, die – gemessen am durchgehend abgehaltenen Gottesdienst – älteste Kirche der Christenheit. Der ursprüngliche Bau geht 305 n. Chr. auf Kaiser Konstantin und seine Mutter Helena zurück, mit der der Pilgertourismus in das Heilige Land seinen Anfang nahm. Die in 1911 wiederentdeckten Bodenmosaiken zeugen noch von dieser Zeit. Sie sind heute zum größten Teil mit Holzparkett geschützt und nur an einer Stelle offen einsehbar.
Drei Konfessionen – römisch-katholisch, griechisch-orthodox und armenisch – teilen sich das Gotteshaus, das traditionell mit der Geburtsstätte Christi in Verbindung gebracht wird. Durch das Mittelschiff führt der Weg in den allerheiligsten Bereich, die Geburtsgrotte des Heilands, wo ein Silberstern auf dem Boden die angebliche Geburtsstelle markiert.
Gemessen am Anlaß, einem der höchsten Feiertage der Christenheit, finden sich Touristen und Pilger nur spärlich im Mittelschiff der Kirche. Auch in der engen Grotte ist genug Platz. Es sind vor allem einheimische Christen, die kommen. Der Beginn des seit Oktober von der US-Administration eingefädelten Waffenstillstands im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas ist offenbar noch zu frisch, um die Besucherströme der Vorkriegsjahre zu reaktivieren. Touristenführer Elias leidet persönlich sehr unter dieser Situation.
Denn der Krieg in Gaza hatte ebenso Auswirkungen auf die palästinensische Westbank, zu der Bethlehem gehört. Früher, so Elias, kamen täglich rund 700 Busse mit 30.000 Touristen. Nicht allein Christen kamen, auch Juden, für die Bethlehem als Geburtsstätte des israelitischen Königs David ebenfalls von hoher Bedeutung ist. Nach Inkrafttreten der Waffenruhe wäre das Niveau gerade auf fünf Prozent des Vorkriegsniveaus eingependelt. Dabei läßt Elias kaum Sympathien für die Hamas erkennen: „Wir sind des Konfliktes müde. Wir wollen Frieden.“ Und doch ist er optimistisch für die Zukunft, daß der mit US-Präsident Donald Trump verbundene Friedensplan die dringend benötigten Früchte trägt, denn: „Ohne Tourismus gibt es kein Leben für die christlichen Palästinenser.“
Doch auch gegen die Israelis spart Elias nicht mit moderater Kritik. Sieben abgeschottete Siedlungen sind um Bethlehem herum verteilt. Kontakte mit ihren ultraorthodoxen Bewohnern bestehen keine. Elias zufolge käme es besonders während der Olivenernte zu Siedlerattacken. „Ich kann auch nicht zur dir nach Hause kommen, mein Haus errichten und sagen, das ist jetzt mein Land“ – unwillkürlich dürfte diese von Elias gebrauchte Veranschaulichung mit dem Unbehagen vieler Deutscher über die Migrationspolitik auf eine denkwürdige Weise zusammenfallen.
Die Sperranlage aus Stahlbeton mit dem militärischen Checkpoint – Elias vergleicht sie mit der Berliner Mauer – macht aus einer Fahrt von Jerusalem nach Bethlehem von theoretisch zwei Minuten eine von bis zu zwei Stunden.
In dem Laden seiner Eltern, wo religiöse Handwerkskunst und Devotionalien – seit sieben Generationen auch aus eigener Produktion – angeboten werden, veranschaulicht er es anhand des Modells einer hölzernen Krippe, vor der in bewußter Anlehnung an die Sperranlage eine herausnehmbare Mauer aufgesteckt ist.
Elias erzählt, daß mit dem Werkstattladen eine von einem „Born-again-Community-Center“ von messianischen Juden marokkanischer Herkunft und institutionell ungebundenen Christen betriebene Armenküche verbunden sei, die ihm zufolge bis zu 60 Familien bediene. Elias zieht alle Register der Rührseligkeit, beklagt das harte Leben in Bethlehem, umschmeichelt den potenziellen Kunden und drängt ihm seine Ware auf. Es beschleicht einen hier das unangenehme Gefühl, im typisch orientalischen Stil eine Geschichte aus 1000undeinerNacht aufgetischt zu bekommen, um Herz und damit die Geldbörse des Besuchers geöffnet zu bekommen. Inmitten eines Ladens für christliche Andenken kommt man sich auf einmal vor wie auf dem Basar.
Auf der anderen Seite in Israel findet sich eine vergleichbare Stimmung. Der 56jährige Uri (Name geändert) hat erst vor wenigen Monaten nach zweijähriger kriegsbedingter Pause mit viel Enthusiasmus seine Tätigkeit als Reiseführer wieder aufgenommen. Aber zu seiner Enttäuschung bleibt der erwartete Touristenansturm bislang aus. Auf der Tour in die antike Felsenfestung Masada befinden sich gerade einmal 13 Reisende aus Übersee in einem Kleinbus, wofür früher ein voller Großbus im Einsatz war.
Die Zurückhaltung erklärt sich Uri nicht allein mit der Vorsicht im Ausland ob der Sicherheitslage: „Die Welt da draußen mag uns Israelis nicht.“ Schnell sei der grausame Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 vergessen worden, verdrängt von der weltweiten Empörung mit maßlosen Vorwürfen des Völkermords über das militärische Vorgehen der Israelis zur Befreiung der von der Hamas verschleppten Geiseln. Eine Vermutung, der man angesichts der massiven Anfeindungen, die Juden seitdem in der westlichen Welt ertragen müssen, kaum zu widersprechen vermag.
Trotz Waffenruhe und der Rückkehr der überlebenden Geiseln sind die Zeichen des Krieges nach wie vor präsent im Land. Sei es durch gelb angestrichene Autowracks am Straßenrand mit der roten Aufschrift „7.10“ – dem Datum des Angriffs durch die Hamas -, sei es durch leere Stühle in gleicher Farbe als Symbol der von den Geiseln und den Ermordeten hinterlassenen Leerstelle oder an den immer noch vielfach an den Fassaden hängenden Transparenten „Bring Them Home Now!“. Die traumatische Erfahrung des 7. Oktober 2023 wird das Land noch lange verfolgen.
Dennoch zeigt sich auch Uri – wie der Palästinenser Elias – optimistisch über die Tragfähigkeit des eingetretenen Friedens. Und vielleicht ist es die israelische Dankbarkeit gegenüber Trump hierüber, weswegen manche Souvenirhändler Kippas – traditionelle jüdische Kopfbedeckungen für Männer – mit dem Porträt Trumps und seinem Erfolgsslogan „Make America Great Again“ in ihr Angebot aufgenommen haben. Andere wiederum haben in Erinnerung an den gemeinsamen Angriff gegen die iranischen Atomanlagen T-Shirts mit dem Aufdruck eines Kampfjets und der Aufschrift „America don’t worry Israel is behind you – Keine Sorge, Amerika, Israel steht hinter dir“ in ihr Sortiment aufgenommen.
Szenenwechsel nach Jerusalem: Das Bild der Altstadt ist vor allem von den ultraorthodoxen Juden geprägt. Aus ihrer Haltung zu Gaza machen sie kein Hehl: „Make Gaza Jewish Again – Macht Gaza wieder jüdisch“, so die an Trumps MAGA-Slogan angelehnte Botschaft eines Banners im jüdischen Teil der Altstadt.
Auswärtige Besucher hingegen sind in der Vorweihnachtszeit weniger anzutreffen, zur Unzufriedenheit der Souvenirverkäufer und der Gastronomen. Selbst die Via Dolorosa, dem Leidensweg Christi zu seiner Kreuzigung, zeigt sich fast leer. In der Grabeskirche, einem der bedeutendsten Kirchen der Christenheit, ist hingegen schon mehr Publikum anzutreffen, allerdings ohne daß es zum Gedränge um die Stationen kommt.
Deutlich mehr Zuspruch hingegen findet am Zugang des Neuen Tors der Weihnachtsmarkt, der sich von einem aus Deutschland kaum unterscheidet, mit Glühwein, Weihnachtsbeleuchtung und einer kaum Besinnlichkeit ausstrahlenden laut schallenden Discomusik.
Das israelische Militär zeigt Präsenz, läßt Besucher auch in bestimmte Bereiche nicht durch. Und dennoch hat man nie das Gefühl, sich in einer Kriegszone zu bewegen.
Heiligabend in der Jerusalemer Altstadt: Der gespannten Ruhe nach dem Krieg zum Trotz können sich die Kirchen über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Doch die gut angenommenen Gottesdienste, zu denen sich auch nicht-christlichen Israelis gesellen, können nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Randgruppe der Christen im Heiligen Land weiter ausdünnt, auch in Jerusalem.
Der Nahost-Experte Dieter Vieweger beschreibt die Jerusalemer Situation als eine, in der neben dem Streit um undurchsichtige Grundstücksgeschäfte „die Schändung von Friedhöfen, die Zerstörung von Kirchen, Hassgraffitis, Spuckattacken gegenüber Klerikern auf der Straße und auch verbale Angriffe in den vergangenen Jahrzehnten enorm zugenommen haben“. Der Lateinische Patriarch Pizzaballa macht hierfür eine „neue Generation von Siedlern“ sowie „ein allgemeines Klima der Gewalt im Lande, das wir sowohl in der israelischen als auch in der palästinensischen Gesellschaft beobachten können“ verantwortlich.
Aktiv zeigen sich an Heiligabend auch die deutschen Angebote, wie dem des deutschsprachigen Gottesdienstes der evangelischen Erlöserkirche. Und auf dem Zionsberg am südlichen Ende der Altstadt bereiten sich die Benediktinermönche der ebenso deutschsprachigen Dormitio-Abtei auf die nächtliche Wallfahrt zur Geburtskirche nach Bethlehem vor, wo sie ihrer eigenen Tradition entsprechend, eine Rolle mit Namen von Menschen, die sich hierfür mit ihren Gebetsanliegen eintragen ließen, mitführen. Wenn seine lokale Basis schrumpft, wird die künftige Präsenz des Christentums an seiner Entstehungsstätte wird vor allem durch solche auch von außen getragenen Institutionen aufrechterhalten werden müssen.
















 „Barbaren“ erworbenen Fähigkeiten allein wollte sich Konstantin nicht verlassen. Denn der Legende nach war es göttlicher Beistand, den Konstantin letztlich für sich verbuchen konnte. Durch einen Traum vor der Schlacht eingegeben, befahl er seinen Soldaten auf ihren Schildern das Christusmonogramm Chi-Rho – das von einem X durchkreuzte P – als „magisches Symbol“ auf ihre Schilde aufzutragen. Damals wie heute sind es vor allem Symbole, die Menschen und Armeen in Bewegung setzten.
„Barbaren“ erworbenen Fähigkeiten allein wollte sich Konstantin nicht verlassen. Denn der Legende nach war es göttlicher Beistand, den Konstantin letztlich für sich verbuchen konnte. Durch einen Traum vor der Schlacht eingegeben, befahl er seinen Soldaten auf ihren Schildern das Christusmonogramm Chi-Rho – das von einem X durchkreuzte P – als „magisches Symbol“ auf ihre Schilde aufzutragen. Damals wie heute sind es vor allem Symbole, die Menschen und Armeen in Bewegung setzten.