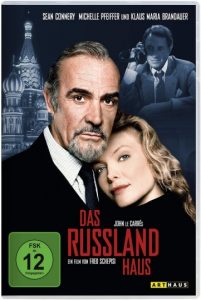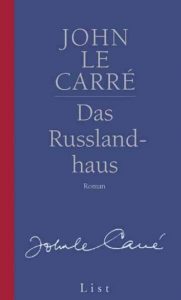Dean Koontz gehört zu den erfolgreichsten Autoren phantastischer Literatur aus den USA. 1945 in Everett, Pennsylvania geboren, betätigt er sich seit Ende der 1960er Jahre als freier Autor, zuerst noch unter verschiedenen Pseudonymen, seit den 1980ern durchgehend unter seinem eigenen Namen. Wikipedia beziffert seine Auflage verkaufter Bücher auf die enorme Zahl von 500 Millionen Exemplaren. Einer seiner letzten auf Deutsch veröffentlichten Romane ist der Mystery-Thriller „Der dunkle Himmel“ aus dem vorigen Jahr.
Merkwürdige Dinge gehen darin vor sich. Scheinbar außer Kontrolle geratene Killersatelliten falten ganze Häuser zusammen. Tiere verhalten sich sonderbar. Und aus dem Fernseher und dem Telefon sprechen die Toten zu ihren Angehörigen. Eine davon ist die junge Schriftstellerin Joanna „Jojo“ Chase, deren längst verstorbene Mutter die mysteriösen Worte zu ihr spricht: „Ich bin an einem dunklen Ort, Jojo. Bitte komm und hilf mir.“
Der Ausgangspunkt all dieser Vorfälle deutet auf eine alte Ranch im US-Bundesstaat Montana hin, dem früheren Zuhause in Jojos Kindheit, bevor ihre Mutter und ihr Vater kurz hintereinander auf tragische, beziehungsweise grausige Art ums Leben kamen. Dort, an einem einsamen See, scheint es alles andere als wildromantisch zuzugehen, so wie es dem Klischee von Montana entsprechen müßte. Doch wer steckt hinter all diesen merkwürdigen Ereignissen? Ist es der sadistische Serienkiller Asher Optime, der in einer Geisterstadt in der Nähe gerade zwei seiner Opfer quält und davon träumt, die in seinen Augen parasitäre Menschheit zur Gänze von der Erde zu tilgen? Oder ist es sein Spiritus Rektor, der Sektenführer Xanthus Toller? Und was weiß der mißgestaltete Jimmy, Jojos Freund aus Kindheitstagen? Oder ist in Wahrheit eine viel größere Kraft am Wirken, die seit sehr langer Zeit aus dem Verborgenen heraus die Menschen beobachtet und dabei ist, ihr unerbittliches Urteil über sie zu fällen? Der in den Diensten der US-Regierung im Geheimen agierende Tech-Milliardär Gesh Patel versucht die Fäden, die alles miteinander verbinden, aufzudecken.
Koontz Plot bietet durchaus Spannung, weist aber auch Schwächen auf. Einige Wendungen kommen allzu glatt und plump daher. Und das größte Manko sind zu viele parallele Erzählstränge, die erst am Ende des 474 Seiten umfassenden Romans im Finale einer sturmumtosten Nacht unter einem wahrhaft „dunklen Himmel“ zusammenlaufen. Das Ganze noch versehen mit einem pseudowissenschaftlichen Anstrich über „Synchronizität“, ein auf den Psychoanalytiker C.G. Jung zurückgehender Begriff über „zeitlich korrelierende Ereignisse, die nicht über eine Kausalbeziehung verknüpft sind (die also akausal sind), jedoch als miteinander verbunden, aufeinander bezogen wahrgenommen und gedeutet werden. (Wikipedia)“
Koontz erreicht leider nicht das Niveau eines Sebastian Fitzek oder Andreas Eschbach, die es immer wieder schaffen, jedes Kapitel mit einem Cliffhanger zu beenden, der die Lust auf den Rest der Geschichte antreibt. Bei Koontz bleibt es in zu oft vorhersehbaren Bahnen, die gleichwohl für Fans des Genres durchaus unterhaltsam sein können.
 | Dean Koontz Der dunkle Himmel 480 Seiten, 2024 Festa Verlag 16,99 EUR |