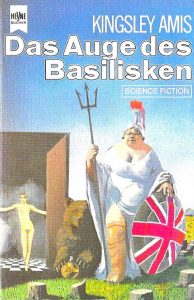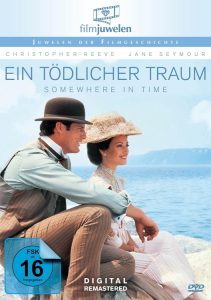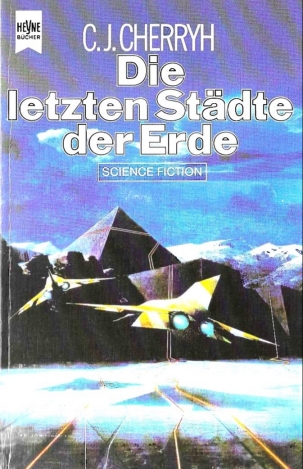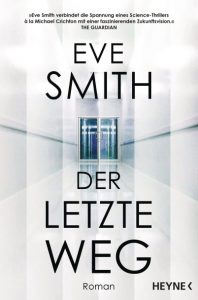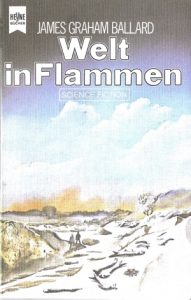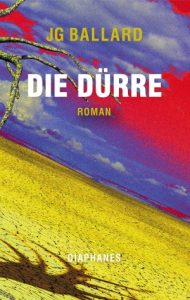Nur vier Jahre nach George Orwells „1984“ erschien 1953 ein Roman, der es gleichfalls zu einer Spitzenstellung im Genre der dystopischen Literatur schaffte. Es war gleich der erste Roman des noch jungen amerikanischen Schriftstellers Ray Bradbury (1920 – 2012), der zum Grundstein seiner literarischen Karriere wurde: „Fahrenheit 451“. Bradbury schuf dieses Werk auf dem Höhepunkt seiner fruchtbarsten Periode von 1946 bis 1955 und wurde damit zum Popularisierer der Science-Fiction.
Der Titel „Fahrenheit 451“ bezieht sich auf die im angloamerikanischen Maßsystem angegebene Temperatur, bei der Buchpapier zu brennen beginnt (im in Deutschland üblichen SI-System 233 Grad Celsius). Und hierin findet man einen der seltenen Fälle, in denen Buchtitel und -inhalt eine geradezu perfekte Konvergenz erreichen. Bradbury entwirft darin eine Zukunft, in der der Besitz von Büchern unter schwere Strafe gestellt ist. An die Stelle der Literatur ist das Fernsehen getreten. Die Menschen lassen sich von wandgroßen Bildschirmen mit geisttötenden Soap Operas berieseln. Die als „Glück“ empfundene Sedierung und Entmündigung der Gesellschaft ist eine selbstgewählte. Das Verwunderliche ist: Für ihre Durchsetzung ist kein allesumfassender Terrorstaat nötig; Verfassung und Demokratie sind nach wie vor formell in Kraft – allerdings ohne Opposition.

Eine Besonderheit ist die Eliminierung unerwünschter Literatur. Publikationen beschränken sich auf Unverzichtbares, wie Bedienungsanleitungen oder ausgewählte Fachliteratur in Kurzform. Belletristik, philosophische oder politische Literatur, die die ganze Bandbreite menschlichen Denkens abbilden, gelten als gefährlich und werden gezielt vernichtet:
„Wir müssen alle gleich sein. Nicht gleich und frei geboren, wie es in der Verfassung steht, sondern gleich gemacht. Jeder ein Abbild aller anderen; dann sind alle glücklich, denn es gibt keine Berge, vor denen sie sich ducken, an denen sie sich messen müssten. Also! Ein Buch ist eine geladene Waffe im Nachbarhaus. Verbrennen Sie es. Nehmen Sie die Kugel aus der Waffe. Brechen Sie den Verstand des anderen. Wer weiß, wer das Ziel eines belesenen Mannes ist?“
Für die Aufrechterhaltung des allgemeinen Buchverbotes sorgt eine Spezialeinheit, deren Aufgabe ursprünglich eine ganz andere war: die Feuermänner. Zusätzliche Repressionsorgane scheinen zur Absicherung des Systems angesichts des künstlich aufrechterhaltenen, desolaten geistigen Zustands der Massen kaum erforderlich zu sein.
Einst waren die Feuermänner das, was wir heute als Feuerwehrmänner kennen, also Spezialisten zur Verhütung und Bekämpfung von Bränden. Doch in Bradburys dystopischer Zukunft, wo die Häuser durch einen speziellen Überzug feuerfest geworden sind, verkehrt sich ihre Aufgabe in das Gegenteil: sie legen Brände, und zwar an Bücher, vorsorglich egal an welche. Erhalten sie hiervon Kenntnis, rücken sie so wie ihre Kollegen aus der Vorzeit in ihren Einsatzfahrzeugen aus. Doch kommt aus ihren Schläuchen nicht Wasser, sondern Kerosin. Es ist diese leicht brennbare Flüssigkeit, mit der die Bücher in Brand gesetzt werden.
Einer dieser Feuermänner ist Guy Montag. Nach außen gibt er sich angepasst, doch innerlich regen sich erste leichte Zweifel. Heimlich hortet er zuhause aus seinen Einsätzen abgezweigte Bücher. Er will wissen, wie gefährlich sie sind. Der Kontakt zu der jungen Außenseiterin Clarisse, die so anders ist als Montags im System von geförderten Drogen und seichter Dauerberieselung aus dem Fernsehen abgestumpfte Gattin Mildred, verstärkt seine Zweifel und seine Verwirrung, indem sie ihm nur eine scheinbar banale Frage stellt: „Sind Sie glücklich?“
Ein dramatisch verlaufender Einsatz wird zum Kipppunkt. Es ist die Besitzerin der Bücher selbst, die vor Montags Augen inmitten ihrer kerosingetränkten Werke das Feuer selbst entzündet und mit ihnen verbrennt. Auch der väterlich klingende Zuspruch seines Dienstvorgesetzten Beatty kann ihn nicht mehr in der Spur des sozial erwünschten Verhaltens halten. Aus dem Zweifler wird der Rebell.
Montags Bücherversteck fliegt durch die allgegenwärtige Überwachung auf. Doch statt tatenlos ihrer Verbrennung zuzusehen, richtet er den Kerosinbrenner auf Beatty und verbrennt ihn. Montags Flucht mit der Unterstützung des früheren Literaturprofessors Faber wird zum Höhepunkt der live übertragenen Abendunterhaltung im Fernsehen, die als eine Art Fuchsjagd inszeniert wird. Doch seine Flucht glückt. In der Wildnis außerhalb der Stadt trifft er ausgerechnet auf eine Gruppe Waldgänger, denen eines gemeinsam ist: Mittels einer speziellen Memoriertechnik bewahren sie in ihren Köpfen den Inhalt jeweils eines Buches wortwörtlich auf und bewahren sie so vor dem Vergessen.
Bradburys „Fahrenheit 451“ wird allgemein als Parabel auf die Zeit des McCarthyismus interpretiert, als der amerikanische Senator Joseph McCarthy (1908 – 1957) zum Wortführer einer Bewegung wurde, die vermeintliche Kommunisten und kommunistische Verschwörer im Staatsapparat zu enttarnen suchte. Im aufkommenden Kalten Krieg mit der Sowjetunion entstand in den USA ein Klima politischer Paranoia mit Denunziation und Spitzelwesen, in welchem die Tribunale des „Komitees für unamerikanische Umtriebe“ zu Hexenjagden gerieten, in denen zahlreiche Existenzen vernichtet wurden. Das Fernsehen, das damals in seiner Verbreitung seinen ersten Siegeszug durchlief, beförderte McCarthys Machenschaften in so gut wie jeden amerikanischen Haushalt. Auch kam es zu Aussonderungen und Verbrennungen unliebsamer Literatur.
Doch es wäre ein Fehler, „Fahrenheit 451“ eine ausschließliche Zeitgebundenheit zuzusprechen. Bücherverbrennungen gab und gibt es zu allen Zeiten. In Bradburys Meisterwerk finden sich zahlreiche Stellen, die bei gewissen Vorkommnissen unserer Zeit ein geradezu visionäres Vorbild darstellen. Da ist die Kritik an der die Sinne betäubenden Massenkultur und der Formierung einer kollektive Zwänge ausübenden Massengesellschaft, die weder dem kritischen Individuum noch dem eigenständigen Geist einen Platz einräumen will. Bücherverbrennungen sind heutzutage zwar nur Ausnahmeerscheinungen, doch werden immer mehr Bücher Restriktionen unterworfen oder aus politischen Gründen vom Mainstream ferngehalten.
Selbst Klassiker erhalten Triggerwarnungen, Neuerscheinungen werden vorab von „Sensitivity Readern“ im Auftrag von Verlagen darauf geprüft, ob sie anstößige und verletzende Inhalte enthalten. Die Autorenfreiheit und die Freiheit des Lesers bleiben auf der Strecke. Autoren, die gegen den Zeitgeist verstoßen, werden gar aus ihrem Verlag geworfen, so wie es Thilo Sarrazin und Monika Maron erging. Die Verlage selbst unterwerfen sich den Vorgaben der political correctness, so daß kritische und herausfordernde Literatur kaum in gedruckter Form zum Leser findet. Es entsteht ein Verhinderungskartell vom Feuilleton der Mainstreampresse über den ÖRR bis zu den Verlagen, Buchhändlern und Buchhandelsketten.
Einer der bisherigen Tiefpunkte war 2017 die nachträgliche Aussonderung von Rolf Peter Sieferles „Finis Germania“ sowohl aus der Liste der „Sachbücher des Monats“ wie auch aus der Spiegel-Bestsellerliste. Daß diese konzertierte Aktion des sogenannten Kulturbetriebs zum Rohrkrepierer wurde, beruhigt keineswegs.
Und nur auf den ersten Blick verwunderlich war eine Meldung aus 2022, wonach die Universität Northampton ausgerechnet George Orwells „1984“ mit einem Warnhinweis versah. Vordergründig erfolgte diese Warnung aufgrund der die Studenten als „beleidigend und verstörend“ empfundenen Inhalte, doch kann man darin durchaus auch jenen von Bradbury beschriebenen Vorgang wiederfinden:
„Die Farbigen mögen Der kleine schwarze Sambo nicht. Verbrennen wir es. Die Weißen haben bei Onkel Toms Hütte kein gutes Gefühl. Verbrennen wir es. Jemand hat ein Buch über Tabak und Lungenkrebs geschrieben? Die Zigarettenindustrie wehklagt? Weg damit. Gleichmut, Montag. Frieden, Montag.“
Wenn uns Ray Bradburys „Fahrenheit 451“ eines lehrt, dann das: Literatur, das Buch an sich, ist stets eine bedrohte Art. Für seine Gefährdung braucht es keinen totalitären Machtstaat. Es reicht dazu eine gleichgültige Masse, die die verfügte Entmündigung durch die den Zeitgeist bestimmenden Kräfte, glücklich hinnimmt, wobei jene vorschreiben, was man zu lesen hat.
 | Ray Bradbury Fahrenheit 451 272 Seiten, 2020 Diogenes 25,- Euro |