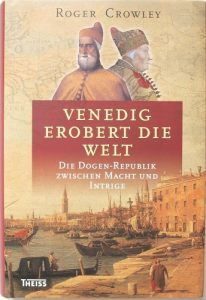„Ich war eines dieser Kinder mit einer trostlosen Zukunft. Ich hatte die High School fast nicht geschafft. Ich hätte mich fast der tiefsitzenden Wut und Verbitterung ergeben, die alle in meinem Umfeld erfasst hatte. Heute sehen mich die Leute an, sie sehen meine Arbeit und das Diplom einer Eliteuniversität, und sie gehen davon aus, dass ich eine Art Genie bin. Ich halte diese Theorie – bei allem Respekt für diese Leute – für ganz großen Blödsinn. Welche Talente ich auch haben mag, ich hätte sie beinahe verschwendet, wenn mich nicht einige liebevolle Menschen gerettet hätten.“ (J.D. Vance, „Hillbilly-Elegie. Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise“)
Mir fällt auf Anhieb kein anderes Buch aus den USA ein, das in den vergangenen Jahren auch auf unserer Seites des Atlantiks so erfolgreich war, für so viel Aufsehen sorgte, wie „Hillbilly-Elegie“ von J.D. Vance. In seiner 2016 erschienenen Autobiographie schildert der heutige amerikanische Vizepräsident seinen kaum fassbaren Aufstieg aus der Armut im mittleren Westen der USA zu einem erfolgreichen Anwalt mit Abschluß der Elite-Universität Yale.
Auch Noch-Kanzler Scholz lobte das Buch als eine „berührende persönliche Geschichte“. Sein Lob dürfte er spätestens zu Vance spektakulärem Auftritt auf der Münchener Sicherheitskonferenz zutiefst bereut haben, nicht allein, weil Vance den Europäern die Abkehr von demokratischen Werten vorhielt, sondern ausgerechnet lieber der Oppositionspolitikerin Alice Weidel den Vorzug für ein Gespräch gab, als ihm, dem absehbaren Kanzler auf Abruf.
Gerade deswegen, weil gerade so viele Dinge in Washington – und davon beeinflußt – auch hier in Bewegung geraten, war es für mich endlich an der Zeit, Vances Biographie, die schon einige Monate im Stapel der ungelesenen Bücher verschwunden war, endlich zur Lektüre hervorzuholen. Es war schon längst überfällig.
Für Vance konnte es kaum einen schlechteren Ort geben, um geboren zu werden, als Middletown im US-Bundesstaat Ohio, kein ungeeigneteres Milieu, um aufzuwachsen, als das der Hillbillys. Die Hillbillys sind die Abkömmlinge ulster-schottischer Emigranten, die sich vor allem im Bereich der Appalachen angesiedelt haben. Sie zeichnen sich nicht nur durch ihre eng verzahnten Großfamilienverbände aus. Sie sind ebenso bekannt für die Kultivierung von gewissen problematischen Verhaltensweisen, die ihnen vor allem in den heutigen Zeiten das Fortkommen sehr schwer machen.
In diese Verhältnisse wurde J.D. Vance 1984 hineingeboren. Geordnete Familienverhältnisse konnte er unter seiner Mutter nie erfahren, bei der die Lebenspartner in einer „Drehtür der Vaterfiguren“ ein und aus gingen. Sein leiblicher Vater gab ihn zur Adoption frei. Der familiäre Alltag war geprägt von Gewalt und Aggression. Seine Mutter kam kaum mit ihrem Leben klar und am wenigsten mit der Verantwortung für ihre zwei Kinder – ein Leben zwischen Landminen: „ein falscher Schritt und Rumms“. Zwar schaffte sie immerhin die Ausbildung zur Krankenschwester, jedoch hielt sie es kaum bei einer Stelle aus. Später verschärfte Heroin ihr alkoholbedingtes Suchtproblem.
Zum rettenden Anker für den jungen Vance wurden die im üblichen Slang Mamaw und Papaw genannten Großeltern mütterlicherseits, die ihm Halt und Geborgenheit gaben, vor allem die Großmutter, eine verrückte Waffennärrin, die sehr schnell ungemütlich werden konnte. Sie waren Menschen ohne Schulabschluß, die in ihrem Leben hart kämpfen mußten. Vor allem die Großmutter motivierte den Jungen, trotz seiner Lernschwierigkeiten in der Schule am Ball zu bleiben. Wenn J.D. jemanden zu Dank verpflichtet ist, dann diesen Menschen:
Meine Großeltern – Mamaw und Papaw – waren fraglos und uneingeschränkt das Beste, was mir hätte passieren können. Sie verbrachten die letzten beiden Jahrzehnte ihres Lebens damit, mir den Wert von Liebe und Verlässlichkeit zu zeigen und die Lehren fürs Leben mit auf den Weg zu geben, die die meisten Kinder von ihren Eltern bekommen. Beide haben dazu beigetragen, dass ich das Selbstvertrauen und die Möglichkeiten bekam, um eine reelle Chance auf den amerikanischen Traum zu haben.
Nach der High-School kam die ebenso prägende Dienstzeit bei den Marines, die Vance Disziplin vermittelten. Zwar war er nicht in direkte Kampfeinsätze eingebunden, aber er lernte im Irak die Schlachtfelder der Moderne aus nächster Nähe kennen. Und nicht zu vergessen: Seine Funktion als Presseoffizier dürfte ihm eine wertvolle Lehrzeit für seine spätere politische Karriere gewesen sein.
Unerwartet erhielt er nach seiner Armeezeit durch ein Stipendium für ärmere Studenten die Möglichkeit zum Jura-Studium an der Elite-Universität Yale. Es sollte sich als ein weiterer glücklicher Eckstein seiner Biographie erweisen. Hierüber erhielt er Zugang in die ihm bis dahin vollkommen ferne Welt der Oberschicht. Geradezu humorvoll lesen sich jene Passagen, in denen er beschreibt, wie er vollkommen hilflos ohne Kenntnis der Etikette die Sphären dieser ihm so fremden Welt betritt. Es muß vor allem wie ein Kulturschock für ihn gewesen sein, über seine Frau ein Familienleben kennenzulernen, das so viel anders – stabiler, ruhiger und freundlicher – als das war, was er erlebt hatte.
Was sich für Vance erfüllt hat, ist nicht mehr und weniger als der amerikanische Traum: Der Aufstieg aus den ärmsten Verhältnissen aus eigener Kraft. Ohne jede Scheuklappe benennt Vance die Ursachen der Krise der weißen Arbeiterschicht, die vielen anderen gleicher Herkunft diesen Aufstieg verwehrt. Es ist nicht allein die Deindustrialisierung; es sind vor allem die extrem prekären Familienverhältnisse, unter denen die Kinder nicht jenes soziale Kapital erwerben können, das allein für ein normal erfolgreiches Leben notwendig ist. Stattdessen schiebt man die Schuld lieber auf andere, rutscht in die Kriminalität ab und versucht seine Not mit Drogen zu dämpfen.
Der Staat erweist sich kaum als Hilfe und bewirkt oft das Gegenteil, indem er die Möglichkeit zum Sozialbetrug eröffnet. Der Glaube an den Wert harter Arbeit ist weitgehend verloren gegangen. Oder die Bürokratie erweist sich als Hürde dort, wo naheliegende Lösungen möglich wären. Für Vance muß die Rettung aus dieser Misere in erster Linie aus einer Verhaltensänderung der Gruppe selbst kommen:
Wenn ich gefragt werde, was ich an der weißen Arbeiterschicht am liebsten ändern würde, sage ich: „Das Gefühl, daß unsere Entscheidungen keine Folgen haben.“
Vance Autobiographie ist vor allem jungen Menschen zu empfehlen, die oftmals in Selbstzweifeln vor ihrem weiteren Lebensweg stehen, vor allem wenn sie mit Problemen zu kämpfen haben, die ihnen kaum Platz für Zukunftsoptimismus lassen. Sicherlich wird es nicht jedem den Weg an die Spitze weisen. Aber vielleicht eine Vorstellung davon geben, was möglich ist, wenn man sich nicht von widrigen Verhältnissen niederdrücken läßt.
Doch auch auf aktueller politischer Ebene trägt dieses Buch einiges bei zum Verständnis des Politikers Vance, der sich einen „modernen Konservativen“ nennt: Sein Herz hängt zuerst an seinem eigenen Land, seinen eigenen Landsleuten, deren Wohlergeben er als erstes im Fokus hat. Seine Wurzeln, seine Verbundenheit zu den Menschen seiner Herkunft hat er nie abgelegt, hat er nie verleugnet. Und genau das dürfte einer der wichtigsten Gründe dafür sein, warum „der Mann aus den Bergen“ in der Trump-Administration zu den treibenden Kräfte gehört, die den Ukraine-Krieg endlich hinter sich lassen wollen, so wie er es vergangene Woche in der denkwürdigen Presserunde im Oval Office gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Selensky der ganzen Welt drastisch vorgeführt hat. Seine Landkarte der Welt dürfte in erster Linie die USA umfassen, nicht aus einem kleingeistigen Provinzialismus heraus, sondern weil er die Ängste, Sorgen und Nöte der Menschen, denen er als zweithöchster Repräsentant seines Staates zuerst verpflichtet ist, aus erster Hand kennt.
Genau das ist es, was jeder Politiker der kommenden Bundesregierung vor Augen haben sollte, wenn er mit den Vertretern des „neuen Sheriffs“ in Washington zusammentrifft. Es wäre dem voraussichtlichen Bundeskanzler Merz dringend angeraten, die Lektüre der „Hillbilly-Elegie“ nachzuholen, falls er es noch nicht getan hat, um ein besseres Verständnis seiner neuen Partner in Washington zu erhalten. Besser wäre es.
 | J.D. Vance Hillbilly-Elegie Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise 304 Seiten Yes Publishing, 2024 24,- EUR |